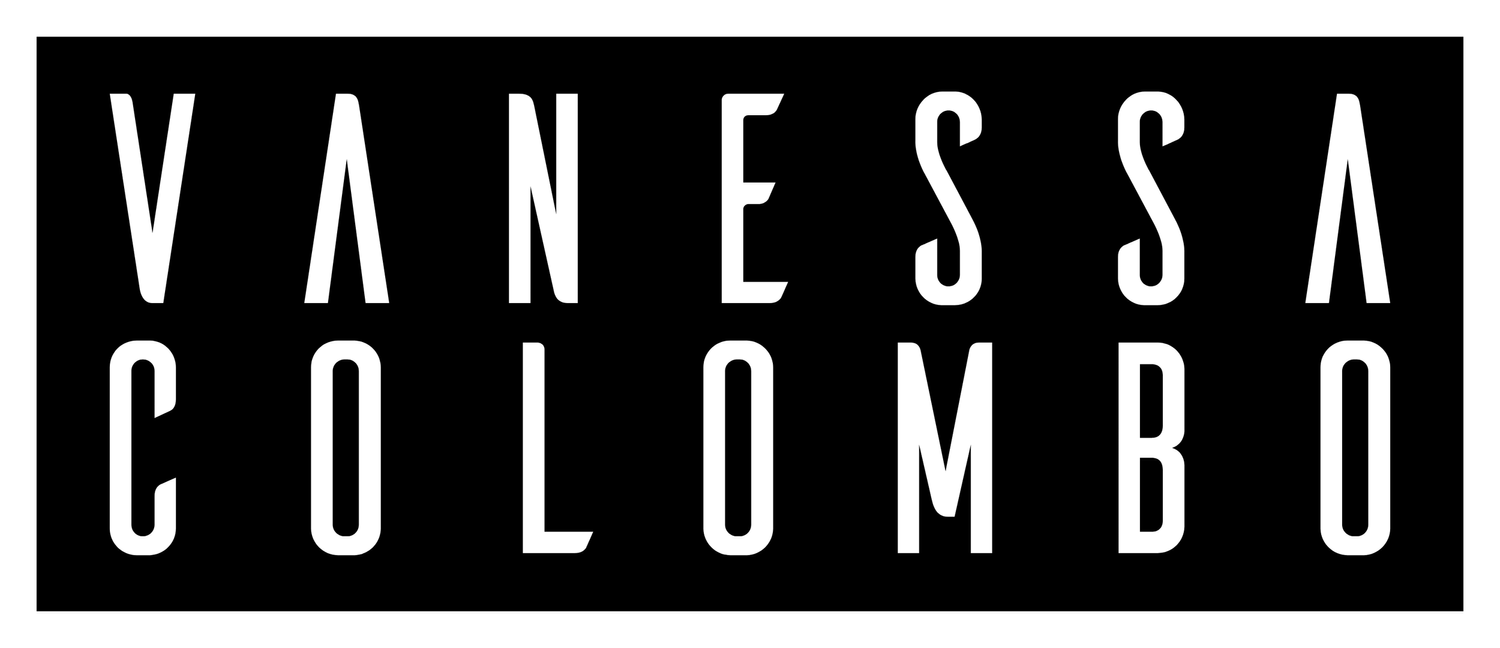Barrierefrei posten: So geht’s auf Social Media
„Über wie viel Prozent der Nutzer sprechen wir, Vanessa, die einen Screenreader nutzen oder darauf angewiesen sind? Das würde mir bei der Einordnung der Nützlichkeit von Barrierefreiheiten sehr helfen.“
Ein Kommentar unter meinem Beitrag auf LinkedIn hat mich zum Nachdenken gebracht. Nicht die Frage an sich, sondern die Haltung dahinter hat mich beschäftigt.
Denn ganz ehrlich: Was spielt die Prozentzahl für eine Rolle? Auch wenn es nur 1 % wären, warum sollten diese Menschen von Inhalten ausgeschlossen werden? Barrierefreiheit ist kein Extra, sondern ein Menschenrecht.
Und es betrifft längst nicht nur Menschen, die Screenreader nutzen. Auch kognitive Einschränkungen, temporäre Beeinträchtigungen oder schlicht eine schlechte Internetverbindung können dazu führen, dass Inhalte nicht nutzbar sind.
Barrierefreiheit heisst: Lesbarkeit, Verständlichkeit, Inklusion. Auch und gerade auf Social Media. Und genau darüber sprechen wir heute.
Zahlen, die zeigen, warum Barrierefreiheit uns alle betrifft
Laut der Weltgesundheitsorganisation leben weltweit rund 15 Prozent der Menschen mit einer dauerhaften Beeinträchtigung, wie Blindheit oder neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose. In der Schweiz betrifft das etwa 1,8 Millionen Menschen, rund 29 Prozent davon leben mit starken Beeinträchtigungen (z. B. Menschen, die ohne Hilfsmittel nicht kommunizieren können).
Dazu kommt ein wachsender Anteil älterer Menschen: Derzeit sind rund 18 Prozent der Schweizer Bevölkerung über 65 Jahre alt, Tendenz steigend.
Auch du könntest morgen betroffen sein: Ein gebrochener Arm, eine vorübergehende Sehschwäche oder einfach eine laute Umgebung – schon wird klar, wie hilfreich barrierefreie Inhalte sein können.
1. Emojis: Charmant, aber tückisch
Ich mag Emojis. Sie lockern Texte auf, zeigen Emotionen, wirken nahbar. Aber Screenreader lesen sie alle einzeln vor, mit Beschreibung.
Screenreader sind Programme, die Inhalte wie Texte, ALT-Texte oder Formularfelder vorlesen und blinden oder sehbehinderten Menschen bei der Navigation auf Webseiten oder in Apps helfen.
Beispiel
„Ich liebe meinen Job 😍😍“
wird zu
„Ich liebe meinen Job. Lächelndes Gesicht mit Herzaugen. Lächelndes Gesicht mit Herzaugen.“
Für Betroffene kann das schnell mühsam oder verwirrend werden.
Und spätestens bei fünf Emojis innerhalb eines ganzen Satzes wird es ein Ding der Unmöglichkeit zu verstehen, was eigentlich die Aussage des Satzes war.
Meine Tipps:
Emojis sparsam einsetzen
Setze die Emojis am Satzende ein, losgelöst vom Satz.
Verwende das Emoji nicht als alleinige Information. Beispiel: Das „✍🏼” als Ersatz für „schreiben“ ist ein No-Go.
2. Fancy Fonts: Schön, aber unsichtbar
Kennst du diese kursiven oder fetten Schriftarten, die aus dem Raster fallen? Sie sehen für manche toll aus, sind aber leider oft nicht lesbar für Screenreader oder Browser. Denn sie bestehen aus Sonderzeichen, nicht aus richtigen Buchstaben.
Mein Tipp:
Bleib bei den Standardschriftarten der Plattformen. Es ist kein Zufall, dass Plattformen keine eigenen Optionen für fette oder kursive Fonts bieten.
Die normale Schrift ist nicht nur barrierefreier, sie wirkt in meinen Augen auch weniger werberisch und dadurch authentischer.
3. Hashtags: #EasyLesbarMachen
Hashtags können wichtig für Reichweite sein. Aber: Ein #sowaskannmannichtlesen ist schwer erfassbar, besonders für Screenreader oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen, für die klar strukturierte und gut gegliederte Inhalte wichtig sind.
Mein Tipp:
Besser so: #SoWasKannManNichtLesen
Das nennt man CamelCase: Jedes Wort wird mit einem Grossbuchstaben begonnen. Screenreader erkennen Grossbuchstaben als Wortanfang. So hören Nutzer:innen den Hashtag:
„Hashtag – So – Was – Kann – Man – Nicht – Lesen“
statt
„Hashtag – sowaskannmannichtlesen“
Übrigens: CamelCase-Hashtags sind nicht nur besser lesbar, sondern können sich auch positiv auf die Suchmaschinenoptimierung auswirken.
4. ALT-Texte: Kleines Feld, grosse Wirkung
ALT-Texte beschreiben, was auf einem Bild zu sehen ist. Sie werden von Screenreadern vorgelesen und helfen auch Suchmaschinen beim Verstehen des Bildinhalts.
Meine Tipps für gute ALT-Texte:
Klar & prägnant: Beschreibe das Bild in wenigen Worten.
Kontextbezogen: Der Text sollte zum Inhalt der Seite passen.
Keine Wiederholung: Was bereits im Fliesstext steht, muss nicht noch im ALT-Text stehen.
Frage dich immer beim Schreiben:
Wer ist auf dem Bild zu sehen?
Was ist relevant?
Was hilft zum Verständnis des Bildes?
Beispiele:
Suboptimal: „Bild von einer Grafik“
Besser: „Infografik mit Verkaufszahlen: Umsatzsteigerung um 20 % im vierten Quartal“
Bei einem Selfie oder einem Portraitfoto, wie das hier von mir, kommt es beispielsweise darauf an, was das Bild kommunizieren soll.
Geht es um dich? Oder um die Stimmung? Den Ort?
Wir könnten hier also je nach Thematik schreiben:
Stimmung: Vanessa trinkt lächelnd eine Tasse Kaffee.
Ort: Vanessa sitzt in der Küche am Fenster, umgeben von Pflanzen.
Beschrieb: Frau mit langen Haaren schaut aus dem Fenster.
5. Untertitel: Nicht nur für Hörgeschädigte
85 % der Social-Media-Videos werden ohne Ton geschaut. Weil Menschen unterwegs sind, weil sie nicht stören wollen oder weil sie nichts hören können.
Lösung: Untertitel. Sie helfen allen und machen deine Inhalte sofort verständlicher. Neben Untertiteln können auch Audiodeskriptionen sinnvoll sein – sie beschreiben das visuelle Geschehen für blinde oder sehbehinderte Menschen und sorgen so für mehr Inklusion.
Mein Tool-Tipp:
Söbs generiert aus Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch oder Italienisch automatisch hochdeutsche Untertitel.
6. Kontraste in Slides: Sichtbar für alle?
Ein häufiger Designfehler: Weisser Text auf hellem Hintergrund. Oder zu viel Farbe, zu wenig Klarheit. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen – oder einfach bei Sonnenlicht – wird das schnell unlesbar.
Mein Tipp:
Teste deine Slides mit einem Kontrast-Check oder lass eine andere Person deine Slides durchsehen – manchmal sieht man es selbst nicht mehr.
Kontrast-Checker:
Die rechtliche Lage in der DACH-Region
Ab 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) für viele Unternehmen in Deutschland. In Österreich setzt das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) ebenfalls die EU-Richtlinie 2019/882 um.
In der Schweiz regelt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) die digitale Barrierefreiheit. Öffentliche Webseiten müssen bereits heute barrierefrei gestaltet sein. Für private Unternehmen bestand bisher noch keine direkte Verpflichtung – allerdings dürfen ihre digitalen Angebote keine Diskriminierung verursachen.
Ab dem 28. Juni 2025 orientiert sich die Schweiz stärker an den EU-Vorgaben. Das heisst: Wer digitale Produkte und Dienstleistungen in der EU vertreibt, muss diese Anforderungen erfüllen – auch als kleines Unternehmen und aus der Schweiz heraus.
Fazit: Inklusion beginnt bei dir
Barrierefreiheit klingt nach Extra-Aufwand, ist aber mit wenigen Griffen umsetzbar. Und wie bei fast allem eine Frage der Gewohnheit.
Du musst keine Expertin sein, um deine Inhalte zugänglicher zu machen. Ein bewusster Blick reicht oft schon, um Barrieren zu vermeiden.
Im nächsten Blog-Beitrag zeige ich dir, wie du Texte so formulierst, dass sie wirklich alle verstehen – mit praktischen Tipps zur einfachen Sprache, klarer Struktur und barrierefreier Textgestaltung.
Du willst deine Social-Media-Texte barrierefrei(er) machen?
Ich unterstütze dich gerne: Beim Redigieren, Strukturieren oder der Wahl der richtigen Sprache. Schreib mir und wir sorgen gemeinsam dafür, dass dein Content wirklich alle erreicht.
FAQ: Häufige Fragen zu Barrierefreiheit auf Social Media
1. Was bedeutet Barrierefreiheit auf Social Media?
Barrierefreiheit auf Social Media heisst, Inhalte so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich sind – unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen. Dazu gehören z. B. lesbare Texte, ALT-Texte für Bilder, Untertitel für Videos und klare Hashtags.
2. Warum sollte ich auf Emojis und spezielle Schriftarten achten?
Screenreader können Emojis und nicht standardisierte Schriftarten nur schwer oder gar nicht interpretieren. Das kann Inhalte unverständlich machen – für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder auch für alle, die z. B. veraltete Browser nutzen.
3. Was ist ein ALT-Text und wofür ist er gut?
Ein ALT-Text (Alternativtext) beschreibt den Inhalt eines Bildes. Er wird von Screenreadern vorgelesen und hilft blinden oder sehbehinderten Menschen, visuelle Inhalte zu erfassen. Gleichzeitig verbessern ALT-Texte die Auffindbarkeit in Suchmaschinen.
4. Gibt es gesetzliche Vorgaben für barrierefreie Inhalte?
Ja. In Deutschland und Österreich gelten ab Juni 2025 neue Gesetze zur digitalen Barrierefreiheit. Auch in der Schweiz wird Barrierefreiheit auf Basis der EU-Vorgaben zunehmend zur Pflicht – vor allem für Unternehmen, die digitale Produkte in der EU vertreiben.